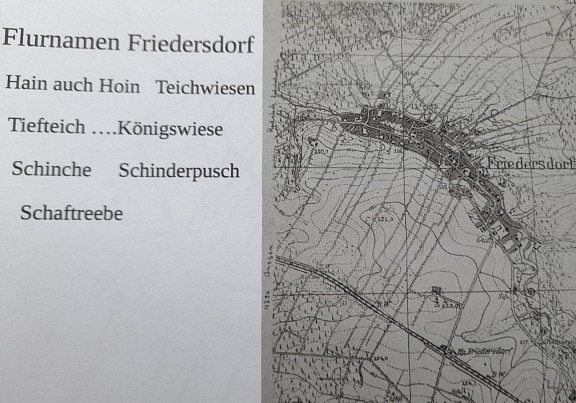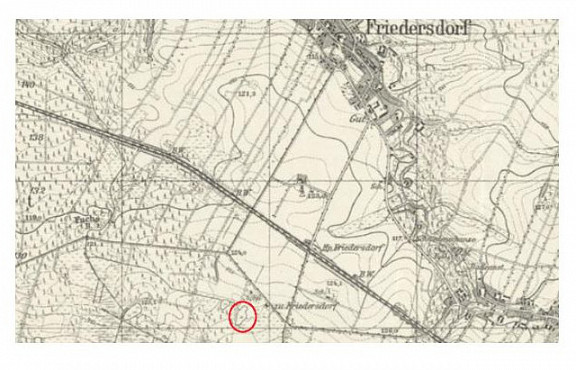Leben früher
Jahrgang 1901 - Aus dem Leben einer Friedersdorferin, erschienen im Sorauer Heimatblatt 1993
Eine Friedersdorferin, die 1992 verstorben ist, schrieb in den letzten Jahren Erinnerungen aus ihrem Leben nieder, beginnend mit Rückblicken auf ihre Kindheit und Jugend. Aus ihrem umfangreichen Manuskript folgt, weitestgehend mit dem Originaltext, eine Nacherzählung.
Als vorletzte von fünf Kindern wuchs sie am Nordostrand von Friedersdorf auf, wo die Eltern eine Häuslerwirtschaft betrieben. Bei der Arbeit mussten Kühe Pflug und Eggen ziehen, außerdem hatten die Eltern zusätzlich noch viel mit Hacke und Spaten zu arbeiten. Das geerntete Getreide droschen sie in der Scheune mit dem Dreschflegel aus und reinigten es mit der Wurfmaschine.
Das Familienleben fand in der großen Stube des Hauses statt, deren Fußboden aus Holzdielen jede Woche gescheuert wurde. Sobald die Töchter alt genug waren, traf sie diese Aufgabe, der sie mit einem Eimer lauwarmen Wassers, darin Soda und etwas Scheelseife und mittels einer selbstgemachten Queckenbürste erledigten. Die Mutter wischte nur noch mit Scheuertuch und klarem Wasser nach. Wenn die Dielen trocken waren, streute die Mutter im Winter ein paar Hände voll weißen Sand darüber, den sie später mit dem Besen in die Dielenritzen fegte. Über das Wochenende legte sie einen langen bunten Läufer in die Stube, hergestellt aus alten Bettbezügen, Decken, Tischtüchern und abgetragenen weiten Frauenröcken, wie sie damals noch Mode waren. Das Material wurde in 3 bis 4 cm breite Streifen geschnitten und diese - jede Farbe für sich - zu Ballen aufgewickelt. Daraus ließ dann die Mutter den Läufer weben.
Wenn es im Herbst zeitig dunkel wurde, diente als Lichtquelle für die Stube eine Petroleumlampe, die die Kinder nicht anfassen durften. In dem großen von der Küche aus beheizten Kachelofen wurde mit etwas Reisig Feuer entfacht und mit dicken Stücken lange brennenden Holzes aufmerksam in Gang gehalten. Sobald aber die kalten Novemberwinde um das Haus wehten, schaffte es der Kachelofen allein nicht mehr die große Stube warmzuhalten. Die Eltern hängten dann die vom Boden geholten inneren Fensterflügel an den Fenstern ein. Zwischen die Doppelfenster kam Moos oder Holzwolle. Zusätzlich stellte der Vater einen eisernen Ofen auf und schloß ihn mit einem langen, mit dickem Draht gut befestigten Rohr, am Schornstein an. Als Heizmaterial für den "Kanonenofen" diente außer Holz auch Kohle. So konnte man der kalten Jahreszeit gelassen entgegensehen.
Das für die Hausschlachtung im Winter gemästete Schwein wog gut und gern an die vier Zentner. Beim Schlachtfest gab es zum Frühstück Buttersemmel und Bohnenkaffee. Mittags kam Wellfleisch mit Sauerkraut auf den Tisch und Wein für die Erwachsenen, denen später zur Vesper Schnaps eingeschenkt wurde - als "sichere Grundlage" für die hausgemachten verschiedenen Wurstsorten, mit denen die Brote belegt waren. Tage dauerte es um Fleisch und Speck einzusalzen und in eine Tonne zu packen, um die Wurst auf Spieße in der Räucherkammer aufzuhängen.
Draußen waren inzwischen alle Arbeiten erledigt, so dass die Mutter die gleich nach der Ernte gewaschenen Kartoffelsäcke aus der Scheune holen konnte um sie durchzusehen und wo nötig auszubessern. Der Vater kümmerte sich um das Handwerkszeug und schließlich auch um den Kaffeevorrat. Es gab Kaffee aus einer Mischung von Roggen und Gerste, mit Ausnahme an Feiertagen und wenn Besuch kam; dann kochte die Mutter Bohnenkaffee. Sie kaufte davon jedes Jahr fünf Pfund. Von Zeit zu Zeit holte der Vater die Röst-Trommel heran. Nachdem er im Kamin, der sich in der Stube befand, ein Holzfeuer angezündet hatte, stülpte er ein Eisengestell darüber, setzte die Röst-Trommel mit dem Rohkaffee oder der Roggen-Gerste-Mischung darauf und drehte die Trommel so lange, bis die durch das Drehen bewegten Kaffeebohnen - oder im anderen Fall die Körper der Roggen-Gerste-Mischung - gleichmäßig braun waren.
Nach Weihnachten begann die Mutter damit, die Federn, der zehn bis vierzehn vor Weihnachten geschlachteten und verkauften Gänse, zu schleißen. Dabei durften die Kinder helfen; auch eine im Dorf wohnende Tante kam ins Haus, um nachmittags ein paar Stunden zu helfen. Zur Vesper gab es an solchen Tagen Kuchen und Semmelbrot mit Rosinen zum Kaffee. Das Federnschleißen dauerte bis eine Woche vor Fastnacht. Zwei Tage vor Fastnacht kaufte die Mutter Hefe, Mehl, Zucker und etwas Fett, um Pfannkuchen zu backen. Milch, Leinöl und Pflaumenmus als weitere Zutaten waren aus eigener Herstellung immer im Haus. Der gut aufgegangene Teig wurde auf dem Tisch ausgerollt, Pflaumenmus als Füllung in Abständen aufgesetzt und ein schmaler Teigstreifen darübergeklappt, bevor man ein, mit der Öffnung nach unten gehaltenes Glas dazu benutzte, Teigabschnitte auszustechen. Auf dem eisernen Ofen waren inzwischen zwei Kupferpfannen mit Leinöl heiß geworden, so dass mit der eigentlichen Backerei begonnen werden konnte. Auf diese Weise wurden in der Regel zur Fastnacht 70 bis 80 Pfannkuchen gebacken.
An frühe Kindheitsjahre ist die Erinnerung geblieben, dass während der wärmeren Jahreszeit die Kinder häufig an einem Sandberg gespielt haben, der sich hinter der Scheune befand. Die mit im Haus wohnenden Großeltern sahen dabei oft den Kindern zu, gingen aber bei regnerischem Wetter auch mit ihnen in die große Stube, um Märchen und andere spannende Geschichten vorzulesen, denen die Kleinen ganz artig zuhörten.
Aus Jahren des fortgeschrittenen Alters erzählt die Verfasserin aber auch von ganz anderen, durchaus nicht mehr spielerischen Tätigkeiten. So ist beschrieben, dass sie und ihre jüngste Schwester sich von April bis Mitte Mai mit einem Verzehrkorb auf den Weg zum eine viertel Stunde entfernt liegenden Gut machten. Dort kamen in dieser Zeit meistens 15 bis 20 Kinder zusammen, die dort mehrere Stunden Quecken sammelten, Steine auflasen und Diesteln stachen. Die Begleiterin, eine ältere Frau, trug einen langen Stock bei sich. Bemerkte sie, dass die Kinder es mit der Arbeit nicht genau genug nahmen, rief sie sie zurück oder es gab sogar eins mit dem Stock. Immer freundlich dagegen war der Gutsbesitzer, der oft auf die Felder kam und dabei seine kleinen Arbeiter begrüßte. Jeweils sonnabends erhielten die Kinder einen Lohn in Geld ausgezahlt.
Ebenfalls nicht in Vergessenheit geriet bei der Autorin, dass in Friedersdorf Mitte September Kirmes und Schützenfest zusammen gefeiert wurden - drei Tage lang. Dazu stellte ssich auch eine Anzahl von Verwandten ein; sogar ein Onkel aus Kohlfurt, ein Bruder der Mutter, war darunter und blieb gleich acht Tage.
Als die Schulzeit von ihr endete, befand Deutschland sich im Ersten Weltkrieg. Sie zog es deshalb vor - anstatt vielleicht in Sorau einen Beruf zu erlernen - auf dem Land zu bleiben. Sie arbeitete bei einem Bauer in Witzen für die Dauer von drei Jahren und trat danach noch für ein halbes Jahr eine Stellung beim Oberförster in Christianstadt an, um für den Haushalt dazuzulernen. Inzwischen hatte die Flachsröste in Christianstadt den Betrieb aufgenommen und es gelang ihr, dort Arbeit zu bekommen. Von dem Verdienst hatte sie nach Ablauf von drei Jahren ihre Aussteuer anschaffen können und kündigte dann, weil durch die Inflation das Geld seinen Wert verlor. Es folgten Jahre bei Bauern in Friedersdorf und der Hilfe in der elterlichen Häuslerwirtschaft, bis sie ihren künftigen Ehemann kennenlernte, dessen Vater ein halbes Jahr zuvor verstorben war. Auf seinem Hof mit 42 Morgen Ackerland, 18 Morgen Wiese und 60 Morgen Wald gab es viel Arbeit. Ihr künftiger Ehemann war der einzige Erbe. Die Hochzeit fand im Juni 1928 statt. Es folgten Jahre mit unermüdlicher Arbeit. Dazu gehörten auch die Verwirklichung von Plänen für den Hof, die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Erziehung der vier Kinder.